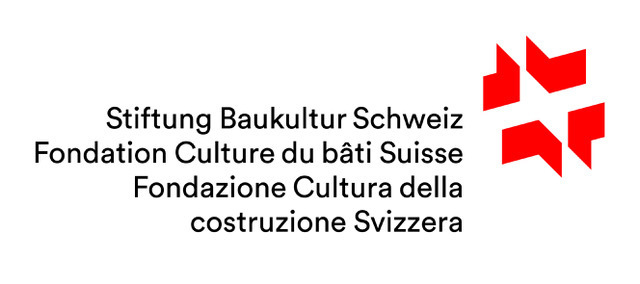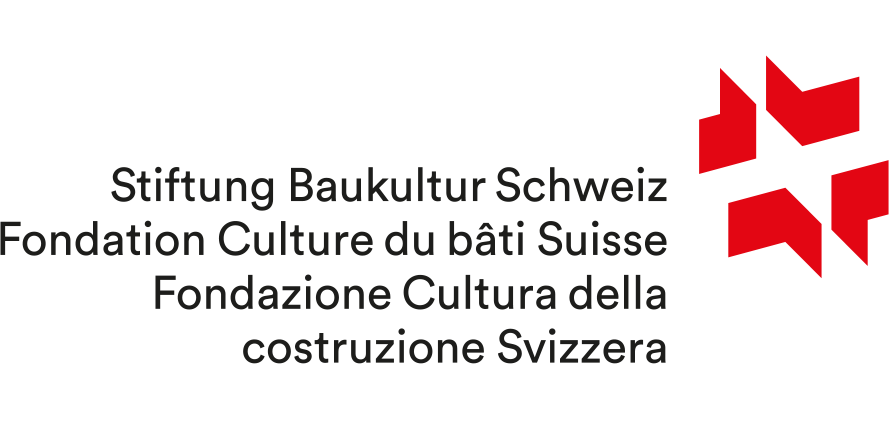Susanne Zenker, SIA-Präsidentin © Reto Schlatter
19 septembre 2025
Stiftung Baukultur Schweiz | D'un point vue personnel
Interview mit Susanne Zenker, Präsidentin des SIA
Susanne Zenker war seit deren Gründung Stiftungsrätin der Stiftung Baukultur Schweiz, langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortliche für Entwicklung bei den SBB Immobilien. Seit rund einem Jahr ist sie Präsidentin des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA. Im Interview blickt sie auf diese Rollen zurück und spricht über strategisches Denken, gute Prozesse und die Bedeutung hoher Baukultur.
Frau Zenker, Sie sind seit einem Jahr Präsidentin des SIA. Was hat sich für Sie persönlich und beruflich am meisten verändert?
Es war ein Wechsel von einer operativen zu einer strategischen Position. Bei den SBB ging es ums Reagieren, Entscheiden und Umsetzen, – oft auch unter Zeitdruck. Meine Arbeit heute besteht weniger aus Feuerwehrübungen, dafür habe ich mehr Zeit für strategische Beschlüsse und Handlungen.
Sie sind auch von einem Unternehmen in einen Verein gewechselt. Wie erleben Sie das?
Meine Tätigkeiten sind ganz anders. Bei den SBB war ich verantwortlich für ein breites Spektrum an Immobilien-Projekten. In dieser Funktion forderten mich unsere Mitarbeitenden mit dringlichen, konkreten Problemen. Im SIA geht es weniger ums Troubleshooting. Hier kann ich mir Zeit zum Denken nehmen. Die langfristige Steuerung in einem Verein erfordert auch eine intrinsische Überzeugung und bietet zugleich Raum für Leidenschaft.
Was gefällt Ihnen inhaltlich beim SIA besonders?
Dass wir gesellschaftliche Themen behandeln. Unsere Vision ist: «Gemeinsam wirkungsvoll für einen nachhaltig gestalteten Lebensraum». Weil die Themen gesellschaftlich relevant sind, ist der SIA politisch sehr aktiv, aber gleichzeitig fern von Parteipolitik – was auch gar nicht anders möglich wäre. Denn unsere 16'000 Mitglieder verteilen sich auf die ganze Schweiz und repräsentieren das gesamte politische Spektrum.
Was vermissen Sie aus Ihrer vorherigen Tätigkeit?
Was ich als Entwicklerin und Architektin vermissen könnte, sind einzelne, reale Bauprojekte. Die sind aber nicht aus meinem Leben verschwunden. Ich kann sie weiterhin von aussen mitverfolgen. Kürzlich war ich in Renens-Prilly, im Westen von Lausanne, und habe mir das Projekt «Central Malley» angeschaut. So kann ich immer wieder beobachten, wie Projekte, an denen ich mitgearbeitet habe, weiter voranschreiten und sich entwickeln.

Visualisierung Projekt «Central Malley» © SBB CFF FFS

Visualisierung Projekt «Central Malley» © SBB CFF FFS
Sie setzen sich seit Langem für strukturierte Entwicklungsprozesse in der Planung ein. Inwiefern ist dieses Prinzip in Ihrer Arbeit beim SIA relevant?
Ich bin überzeugt, dass Projekte, die klar strukturiert sind und präzisen Prozessen konsequent folgen, bessere Erfolgschancen haben. Auch wenn ich als Präsidentin des SIA nicht mehr operativ tätig bin, sind gute Prozesse weiterhin relevant in meinem Alltag. Sie sind für jede Organisation wichtig; zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung. Deshalb versuche ich, die Zusammenarbeit im SIA anhand klarer Prozesse besser zu strukturieren.
Oft sind Planende unter Zeitdruck, und es gibt viele Schnittstellen. Das erschwert strukturierte Abläufe.
Qualität beginnt mit interdisziplinärer Planung. Ohne gut überlegte Planung entsteht keine Qualität. Dafür muss man sich jedoch bewusst Zeit nehmen. Unter Druck haben Viele das Gefühl, keine Zeit mehr für ein sauberes Verfahren oder für Varianten zu haben. Aber wer am Anfang genügend Zeit investiert, spart sie später wieder ein. Es wird beispielsweise weniger Einsprachen geben, wenn Projekte eine politische Akzeptanz gewonnen haben oder die Mängelbehebung entfällt, weil die Details vor Baubeginn sauber durchdacht und gezeichnet wurden.
Es gibt Bauherrschaften, die möchten ganz zu Beginn eines Bauvorhabens bereits Details wie Zimmergrössen festlegen. Liegt es in der Verantwortung der Planenden, hier entgegenzuhalten?
Oft bestellen Bauherrschaften zu präzise und verbauen sich damit unbewusst die nötige Flexibilität, wenn ihre Bedürfnisse zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Planende haben die Verantwortung, bereits zu Beginn die richtigen Prozesse zu definieren und diese auch gegenüber der Bauherrschaft transparent zu erläutern. Man sollte nie mit der Planung beginnen, wenn man noch nicht genau weiss, was man will. Eine gute Planung braucht eine klare Bestellung. Gerade unerfahrenen Bauherrschaften müssen Planende helfen, diese Bestellung zu formulieren.
Eine besondere Herausforderung der Planung liegt darin, Hypothesen über lange Zeiträume zu formulieren. Wie geht man damit um?
Das richtige Timing ist entscheidend. Wenn Projekte zu lange blockiert sind – etwa durch Einsprachen –, verlieren sie an Aktualität. Ich erinnere mich an ein Projekt, bei dem uns Jahre später in einer Volksabstimmung vorgeworfen wurde, kein Mitwirkungsverfahren durchgeführt zu haben. Dabei war das Projekt rund 15 Jahre früher lanciert worden, zu einem Zeitpunkt, als Mitwirkungsverfahren noch kein Thema waren. Aber bei der Abstimmung war das dann verständlicherweise erwartet worden. Man muss sich bewusst sein, dass man immer für eine sich wandelnde Welt plant.
Nachhaltigkeit ist ebenfalls eine Frage des Zeithorizonts. Es ist einfacher, sich die Welt in 10 oder 20 Jahren vorzustellen als in 100 Jahren. Vieles ist ungewiss. Was heisst Nachhaltigkeit für Sie in der Planung?
Nachhaltige Projekte sind solche, die langfristig funktionieren. Für mich beruht Nachhaltigkeit auf den drei Säulen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Dimensionen widersprechen sich im Alltag oft, aber gerade deshalb ist es wichtig, sie im Gleichgewicht zu halten.
In diesem Denken ist die Nachhaltigkeit wie die Baukultur; pluralistisch. Es gibt also mehrere Faktoren, die zu ihrem Gelingen beitragen. Was ist aus Ihrer Sicht die beste Strategie für eine nachhaltige Zukunft?
Wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Aber wir können die besten Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung schaffen, wenn wir die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekte in Einklang bringen. Wie bei der Planung von guten Prozessen gibt es dabei keine Erfolgsgarantie, aber die Chancen auf Qualität steigen.
Hohe Baukultur fasst den Begriff der «Kultur» als Schirmbegriff auf. Haben Sie ein konkretes Beispiel für hohe Baukultur?
Das vom SIA mitentwickelte «Davos Qualitätssystem für Baukultur» hilft hohe Baukultur zu quantifizieren. Als konkretes sehr gutes Beispiel nenne ich gerne das Bahnhofsareal in Renens. Dort treffen guter Städtebau, qualitative Architektur und ein vielfältiges Mobilitätsangebot aufeinander. Die Passerelle über die Gleise wurde zu einem öffentlichen Raum, in dem sich die Menschen gerne aufhalten. Es fasziniert mich, wie diese funktionale Infrastruktur zum lebendigen Aussenraum wurde. Eine solche Qualität ist nur schwer zu erreichen. Die Passerelle war eine gemeinsame Bestellung mehrerer Gemeinden. Sie ist Resultat guter Prozesse und einer gelungenen Zusammenarbeit verschiedener Bauherrschaften. Das Resultat spricht für sich. Dass sich Menschen dort wohlfühlen, ist letztlich der beste Beweis für hohe Baukultur.

Blick auf die Passerelle in Renens © SBB CFF FFS

Blick aus der Passerelle in Renens © SBB CFF FFS
Sie waren von Anfang an Teil der Stiftung Baukultur Schweiz. Was konnten Sie sich in Ihren fünf Jahren als Stiftungsrätin einbringen?
Ich konnte die Sicht der Bauherrschaft einbringen – mit konkreten Erfahrungen aus allen Landesteilen, unterschiedlichen Projektgrössen und -phasen sowie einer Vielzahl von Verfahren. Ich hoffe, das hat dazu beigetragen, den Begriff der Baukultur anschlussfähig für die Wirtschaft zu machen. Denn dort muss er auch wirken.
Gibt es einen Moment, an den Sie sich besonders gerne zurückerinnern?
An die erste Tagung der Stiftung 2021 an der ETH Zürich, mitten in der Covid-Zeit. Da herrschte eine echte Aufbruchsstimmung, eine Art Pioniergeist.

Erste Tagung der Stiftung Baukultur Schweiz 2021: Ein Gruppenfoto, das für die ehemalige Stiftungsrätin Susanne Zenker bis heute Pioniergeist verkörpert. © Stiftung Baukultur Schweiz
Und wohin sollte sich die Stiftung weiterentwickeln?
Hohe Baukultur ist kein selbsterklärender Begriff. Es braucht kontinuierliche Vermittlungsarbeit: gute Beispiele, Gespräche mit Gemeinden und Behörden, Dialog mit der Wirtschaft. Die Stiftung macht das hervorragend. Also: Weiter so und nicht aufgeben!
Vielen Dank für Ihr Engagement und das Gespräch.
Caroline Tanner
Caroline Tanner ist Architektin, Autorin und Philosophin. Sie studierte Architektur an der ETH Zürich und arbeitete mehrere Jahre als Architekturjournalistin bei den NZZ Fachmedien. 2024 hat sie den «Master in Geschichte und Philosophie des Wissens» mit einer Arbeit in Architekturphilosophie mit der Bestnote abgeschlossen.

Stiftung Baukultur Schweiz
Die Stiftung Baukultur Schweiz ist eine nationale, neutrale und politisch unabhängige Stiftung. Im Frühjahr 2020 gegründet, bringt sie Akteure zusammen, schafft Plattformen, initiiert Prozesse und macht sich stark für jene, welche die Grundlagen der Baukultur inhaltlich ausarbeiten oder diese in der Praxis umsetzen.